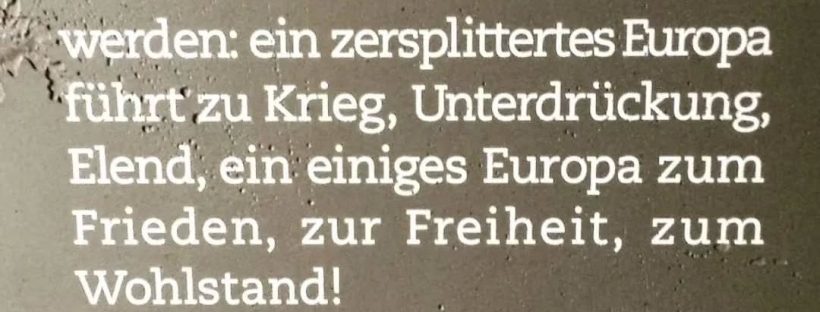Der Vizepräsident der Paneuropabewegung Österreich Stefan Haböck sprach vor Mitglieder des St. Georgs Orden über die europäische Einigung, über Krisen und Erfolge, über Blockaden und Fortschritte. Die Rede wird hier im Wortlaut wiedergegeben.
Als ich Ende des Jahres 2024 mit meinen lieben Freund Vinzenz Stimpfl-Abele, dem Prokurator Ihres geschätzten Ordens, telefonierte, diskutierten wir kurz, welches Thema heute Inhalt dieser Veranstaltung sein könnte. Wir diskutierten kurz, denn es war klar: Wir wollen kein reines Jubeleuropäertum, kein „Europa – quo vadis?“ oder darüber sprechen, wie wunderbar alles läuft in Europa und der Welt.
Denn das tut es nicht. Ganz und gar nicht. Das Hoffnungsprojekt Europäische Union steckt in einer schwierigen Situation. Nicht, dass es nicht früher auch Krisen gegeben habe.
Die gab es massenhaft. Man erinnert sich gerne zurück, an seine Kindheit, seine Jugend, eine vermeintlich bessere Zeit. Nostalgie, wenn man es so will. Angeblich merkt man sich besonders gut Erinnerungen aus der Zeit zwischen dem 10. und 30. Lebensjahr. Ich erinnere mich an meine Kindheit, an meine Jugend sehr gerne zurück. Es war eine wunderbare Zeit.
Keine Krisen, außer für meine Eltern, wenn die Mathematik-Schularbeit anstand. Als ich 10 Monate alt war, explodierte das Atomkraftwerk in Tschernobyl. Als ich 10 Jahre alt wurde, gab es den norwegischen Raketenzwischenfall. In Tokio gibt es einen Terroranschlag, in Oklahoma tötet ein Bombenanschlag 159 Menschen, in Bosnien-Herzegowina fand der Völkermord von Srebrenica statt. In Frankreich kommt es zu einer verheerenden Anschlagsserie, in Israel ebenso. Yitzak Rabin wird ermordet.
In jenem Jahr sterben auch mehr als 8.000 Menschen bei Erdbeben. Und in Oberwart reißt eine Bombenfalle vier Menschen in den Tod. Das war sie also, die angeblich gute alte Zeit.
Krisen gab es schon immer. Und natürlich war für einen 10jährigen ein Attentat in Tokio weit weg. Sehr weit weg. Doch auch für meine Elterngeneration waren alle diese Krisen, wenn sie nicht direkt Einfluss auf unser Land hatte – wie die Balkankriege oder Tschernobyl, als die Kinder nicht im Sandkasten spielen durften – auch nicht allzu nahe. Hauptinformationsquelle waren die Zeitung die man las und der öffentliche Rundfunk. Man darf nicht vergessen, dass erst Mitte der 1990er Jahre Privatradio in Österreich erlaubt wurde.
Heute hat sich die Informationswelt vollständig gewandelt. Die digitale Welt ermöglicht allen per Blick aufs Handy den Abruf von Millionen Informationen aus allen Teilen der Welt in Sekundenschnelle. Jedes 10jährige Kind mit Smartphone kann auf einer chinesisch kontrollierten Plattform rund um die Uhr Hamas-Propaganda konsumieren.
Jede Krise auf der Welt ist plötzlich ständiger Begleiter. Wir werden geflutet mit Informationen, Nachrichten, Analysen und ja, auch Desinformation. Mit dem Smartphone kann ich live die Truppenbewegungen an der ukrainischen Ostfront aus dem Schützengraben mitverfolgen.
Krisen gab es immer. Wir erleben sie nur deutlich intensiver und umfassender. Das wühlt auf und schürt Emotion. Nicht immer Freude. Und nicht umsonst reagieren Algorithmen auf Plattformen besonders gut auf Wut, nicht auf Freude. Anlass zur Freude gibt es aktuell auch sehr selten. Wut ist aber auch nicht die besonders sympathische Alternative.
Doch ich mache ich mir große Sorgen über vieles, was in Europa geschieht.
Mich besorgt die zunehmende Zentralisierung in Europa. In unserem Institut (Institut der Regionen Europas, IRE, Anmerkung) arbeiten wir mit hunderten europäischen Regionen, Städten und Gemeinden zusammen. Dezentralisierung und Stärkung der Regionen ist eines unserer Hauptanliegen. Schließlich ist doch Subsidiarität eines der Grundprinzipien der EU! Ich muss Ihnen aber leider sagen, dass dieses Prinzip schon längst immer weiter zurückgedrängt wird.
Und nicht durch „Brüssel“ alleine. Es sind vor allem die Nationalstaaten, die ein Interesse daran haben, dass Regionen und Gemeinden schwächer sind. Und ja, nicht jeder Staat in Europa ist föderal und dezentral strukturiert, im Gegenteil. Deutschland, Österreich, die Schweiz sind sogar eher Ausnahmen. Am Westbalkan gibt es teilweise keine Regionen im politischen Sinne.
Das Erste, was eher autoritäre Politiker versuchen? Die Gemeinden und Regionen zu entmachten. Wir sahen das bei manchen EU-Staaten, wo Gemeinden finanziell gekürzt wurden und es Pläne gab, Regionen, zum Beispiel Woiwodschaften, aufzuteilen, da diese zu stark wurden. Es gibt Staaten in Europa, wo das Präsidentenbüro über Schulbauten in Gemeinden entscheidet. Das meine Damen und Herren, ist keine Subsidiarität.
Mich besorgt, dass sich Europa wirtschaftspolitisch von seinen Grundwerten, Freihandel, Marktwirtschaft und Innovation wegentwickelt.
Der Politik fällt nichts mehr ein, als steuerfinanziert auf den Konsum zu setzen. Prämie hier, Förderung da. Mich besorgt, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen man spricht, über De-Industrialisierung, Abwanderung von Produktion, Lieferkettengesetz klagen. Schlagworte, oft sicherlich in der politischen Debatte übertrieben, aber alle basierend auf der großen Sorge, dass Europa Gefahr läuft, wirtschaftlich nicht mehr mit der sich rasant verändernden Welt mithalten zu können. Das Gefühl einer Überregulierung, die dazu führt, dass – wie ein deutscher Staatssekretär kürzlich als Beispiel brachte – Steinmetzbetriebe in Deutschland faktisch kontrollieren und bestätigen müssen, dass alle Subunternehmen von Marmor in Indien und China alle sozialen Standards einhalten.
Was die Staaten mit Indien nicht schaffen, wird den kleinen und mittleren Betrieben aufgebürdet. Denn mit Indien verhandelt die EU seit 2007 ein Handelsabkommen mit Festschreibung unverbindlicher Umwelt- und Sozialstandards. Aber ein Unternehmen in Europa soll im totalitären China diese einfordern? Nicht falsch verstehen: Es ist wünschenswert, dass in allen Ländern hohe Sozial- und Umweltstandards gelten. Aber das muss ich politisch vor Ort umsetzen, nicht im harten Wettbewerb stehenden Mittelständlern. Doch wie wollen die Staaten diese Ziele, die sie KMUs aufbürden umsetzen? Seit 1999, also seit 26 Jahren, verhandelt die EU mit den MERCOSUR-Staaten ein Handelsabkommen. Bis heute gibt es keine Einigung. Europas Staaten blockieren. Seit 2013 – 3 Jahre vor der ersten Amtszeit von Donald Trump – verhandelten die EU und die USA das Handelsabkommen TTIP. Bis heute gibt es kein Ergebnis.
Ja, die Vorsicht, oder Angst, vor Handelsabkommen ist nicht neu. Doch selbst die zweite Amtszeit von Donald Trump, einem nationalistischen Protektionisten, führt nicht zu einem Ruck in dieser Frage.
Österreich zum Beispiel ist weiter strikt gegen das Abkommen mit den demokratischen Staaten Argentinien und Brasilien. Ein Land, das zu 60% vom Export von Waren und Dienstleistung in die ganze Welt lebt und dessen KMU-strukturierte Wirtschaft möglichst niedrige Hürden in anderen Regionen der Welt benötigt.
Apropos Brasilien: Man will mit Brasilien zwar kein Handelsabkommen schließen, weil man sagt, dass deren politische, rechtsstaatliche, soziale Standards nicht ausreichend sind. Gleichzeitig fordert man, dass Brasilien doch in der Ukraine vermitteln soll. Für die Ukraine reicht es also, für Maschinenhandel nicht. Mich besorgt, dass Europa bei dem zweiten großen geopolitischen Hebel den es hat, der aktiven Erweiterungspolitik, seit über einem Jahrzehnt bremst.
Meine Damen und Herren, die Erweiterungspolitik Europas war eine der größten Erfolge in der Geschichte Europas. Die Erweiterung der Europäischen Union um Länder, die selbst Grenze zum Sowjetregime waren und später die Erweiterung um jene Länder, die Jahrzehnte unter dem Joch desselbigen litten, war die logische Fortsetzung der Erweiterung der Idee Europas als Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts. Die Erweiterung war getrieben von Politikern, die ihr Land als gleichberechtigter Teil Europas sehen wollten und nicht als Anhängsel von Regimen. Die wussten, dass kein Land mehr allein in der sich verändernden Welt bestehen konnte und die überzeugt waren, dass die Menschen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ein Recht darauf hatten, Teil des freien Europas zu sein und nicht der „Hinterhof“ eines amoralischen Regimes.
Doch der Enthusiasmus ist weg. 2013 trat das letzte Land, Kroatien, der EU bei. Das war vor 12 Jahren. Seitdem hat sich das BIP von Kroatien um 44% gesteigert. Eine schöne Erfolgsgeschichte. Doch vergangen ist der Optimismus. Ersetzt wurde er durch kurzsichtige Politik in den Nationalstaaten, durch nationalistische Demagogie, durch Kleingeistigkeit. Ein Kandidatenland musste seinen Landesnamen ändern, ein anderes steht unter Maßnahmen.
Als front runner gilt jenes Land, dessen Bevölkerung am wenigstens Zustimmung zur EU zeigt und dessen Politik am schärfsten gegen die EU auftritt. Natürlich, viele Länder sind noch nicht bereit Mitglied zu werden.
Eine Umfrage aus einem Beitrittskandidatenland am Westbalkan zeigt, dass 2% der Bevölkerung Vertrauen in das Justizsystem haben. 2 Prozent. Doch ändern wird sich nichts, wenn nicht Europa endlich echtes Interesse zeigt an der Region.
Erweiterungspolitik ist reduziert auf pragmatisches Abarbeiten von Anforderungen, Paragraphen und Verordnungen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist wichtig. Die EU-Rechtsnormen sind Grundlage des Rechtsstaates, sie sollen Willkür verringern, die Länder in das europäische System eingliedern. Doch wer glaubt, dass sich Herzen der Menschen für ein Projekt gewinnen lassen, in dem man ihnen von 23 abgearbeiteten Verordnungen erzählt?
Eine Anekdote lässt mich seit 2023 nicht mehr los. Damals erzählte ein hochrangiger Politiker einer Hauptstadt am Westbalkan, dass Europäische Fonds für ihn überhaupt nicht in Frage kämen. Die Abwicklung sei viel zu kompliziert, während China unbürokratisch Geld zur Verfügung stellt.
Zugegeben: Diese Aussage muss man, angesichts der politischen Situation in jenem Land, mit – wie es der Amerikaner sagt – a grain of salt nehmen. Dennoch: Ein gewisser Eindruck bleibt.
Der Mensch braucht eine Hoffnung. Eine Idee, die ihm gefällt. Jeder pro-Europäer am Westbalkan weiß, dass es in der EU genauso alltägliche Schwierigkeiten gibt, doch trotzdem hält er an der Idee Europa fest. Warum? Weil er (noch) Hoffnung hat.
In der Erweiterungspolitik erfüllt Europa dieses Versprechen nicht mehr. Der Dialog zwischen Serbien und Kosovo ist ein völlig ergebnisloses Ausrichten von Unhöflichkeiten, bisher moderiert von einem Sonderbeauftragten, dessen Heimatland einen der Verhandlungspartner gar nicht anerkennt. Anstatt die Probleme auf höchster politischer Ebene zu lösen, verschob man es in einen Arbeitskreis.
Der Enthusiasmus gegenüber den „neuen Kandidatenländern“ – Ukraine, Georgien, Moldau – ist verschwunden. In Moldau kämpft eine pro-europäische Regierung tapfer gegen den immer noch tiefsitzenden sowjetischen Geist im Land und gegen den Einfluss Moskaus. In Gagausien – einer Provinz, in der die EU die Straßen und Schulen finanziert, stimmen 95% gegen die EU.
Die Ukraine hat in ihrer schwersten schon Erfahrung gemacht mit dem Thema, an dem der EU-Beitritt wohl spätestens scheitern wird, nämlich an der gemeinsamen Agrarpolitik der EU.
Und die Führung in Georgien hat sich entschieden, anstatt bei Ratssitzungen in Brüssel mitzubestimmen, in Teheran zwischen Hamas-Vertretern dem iranischen Präsidenten zum Amtsantritt gratulieren.
Mich besorgt die starke Abhängigkeit Europas von Systemen und Regimen, die weit weg von unserem Wertesystem sind.
Es gibt diesen schönen Ausspruch: Europa lebte von billiger Sicherheit aus Amerika, billiger Produktion aus China und billiger Energie aus Russland.
Bei der Energie ist es mehr als zweifelhaft, dass diese wirklich so billig gewesen ist. Man kann davon ausgehen, dass uns Russland das Gas nicht geschenkt haben wird. Zumindest nicht ohne Gegenleistung. Und diese Gegenleistung war es, die Europa teuer zu stehen kann: Verlust der Souveränität und ein nicht unerhebliches Erpressungspotential durch Abhängigkeit eines Hauptlieferanten. Bis heute – 3 Jahre nach Start der vollen Invasion und 11 Jahre nach dem Start des Angriffs auf die Ukraine – kämpfen zwei EU-Staaten noch mit den Folgen der veränderten energiepolitischen Situation.
2010 begann ich als Assistent für ein Mitglied des Europäischen Parlaments zu arbeiten, der sich auch stark im Energiebereich engagierte. Schon damals war die Position auf EU-Ebene klar: Die europäischen Staaten müssen ihre Abhängigkeiten bei Energie reduzieren, denn: Andere Mächte würden Energie als Waffe einsetzen (was die Erfahrungen der Ukraine schon zu Beginn der 2000er Jahre zeigten). Und mit den Zahlungen in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro jährlich würde Macht politischer Systeme gefördert werden, die nicht unsere Wertvorstellungen teilen.
Zum Vergleich: Der saudische Ölkonzern ARMACO schrieb 2022 161 Milliarden Euro Gewinn. Der italienische Konzern ENI erzielte 4 Milliarden.

Stefan Haböck, rechts, mit dem Prokurator des St. Georgs Orden Vinzenz Stimpfl-Abele.
Doch nicht nur im Energiebereich, auch in Industrie und Forschung hat man durch massive Auslagerung eine andere Macht gestärkt: China.
Es ist völlig klar, dass private Unternehmen effizient wirtschaften müssen und die Kostenstruktur beachten müssen. Niemals wird die EU mit niedrigeren Lohnkosten in weiten Teilen Asiens mithalten können. Und für Entscheidungen privater Unternehmen sollten private Unternehmen auch verantwortlich sein. Doch auch dieser Bereich ist massiv politisiert. Denn in China geht nichts ohne die Partei. Und wie Russland hat es China geschafft, sich ein vielschichtiges, tief durchdringendes Netzwerk in der europäischen Politik zu schaffen.
China produzierte, Europa konsumierte. Was anfangs wie eine win-win Situation aussah, entwickelte sich zu einem Problem für Europa. Denn: Im Gegensatz zum russischen Regime, dessen Kernmerkmal vor allem Korruption ist, entwickelte die chinesische Führung sehr wohl eine Strategie, das Land technologisch, wirtschaftlich und militärisch an die Spitze zu bringen. China wirbt aktiv die besten Studentinnen und Studenten europäischer Universitäten ab. China setzt auf Bildung. Was es langfristig zu einer größeren Gefahr macht als Russland.
China flutet den Weltmarkt mit subventionierten Produkten, seien es Stahl oder eben E-Autos. BYD ist mittlerweile der größte Hersteller von Elektro- und Hybridautos, und setzt nun zum Sprung an, den europäischen Markt zu erobern. Im ungarischen Szeged wird das Unternehmen ein Werk aufbauen – und österreichische Unternehmen der Zulieferbranche sind schon in Gesprächen für Aufträge.
Heute wurde bekannt, dass sich Mercedes einer Klage von Geely (dem chinesischen Joint Venture von Mercedes), BMW und Tesla anschließt – gegen die Strafzölle der EU gegen China. 20% Anteil an Mercedes halten chinesische Investoren.
Die Realität der Weltwirtschaft überholt auch hier die politische Diskussion: Verbrennermotoren hin, E-Autos her – wenn der bevölkerungsreichste Staat der Welt eine Technologie pusht, werden Unternehmen sich darauf einstellen müssen. China tut dies natürlich nicht nur allein aus Sorge um das Weltklima, die Kohlekraftwerke schaltet es noch nicht ab, sondern aus geostrategischen Überlegungen. Und es wirkt.
Problematisch ist, dass es Europa in der Zeit des chinesischen Wachstums aufgrund seiner Arroganz, eine „billige Werkbank“ zu haben nie für notwendig hielt, den Chinesen klarzumachen, dass es gemeinsame Regeln gilt, die einzuhalten sind. Reziprozität wäre das Stichwort. Auch hier agierte die Politik kurzsichtig. 2010 gab es im Deutschen Bundestag eine Enquete zu Deutschland und China, in der unter anderem gewarnt wurde, dass die Joint Ventures bei Technologie deutscher Autobauer mit chinesischen Unternehmen zu einem Abfluss des Know-Hows führen wird, der langfristig deutsche Autobauer verdrängen wird. 15 Jahre später klagen deutsche Autobauer die EU.
Die Reziprozität kann Europa mittlerweile vergessen: China dominiert nun sowohl als Absatzmarkt als auch technologische und politische Macht und hat schon längst begonnen, diese Dominanz abzusichern.
Das Land baut mittlerweile eine Selbstständigkeit auf, um in einem großen Konflikt mit den USA unabhängig agieren zu können. Das bedeutet: Massiver Ausbau der militärischen Kapazitäten. Sicherung und Kontrolle des Rohstoffabbaus sowie der Rohstofflieferketten. Kontrolle der wichtigsten Häfen und damit der Logistik.
Autarkie wird nie ein Land erreichen können. Auch China importiert Rohstoffe – Kobalt kommt zu 75% aus der Demokratischen Republik Kongo. Nickel wird zu großem Teil aus Indonesien importiert. Indonesien wurde 2025 in BRICS aufgenommen. Autarkie ist illusorisch, jedoch läuft es auf eine Abkoppelung hinaus. Mit inländischem Know-how, eigenen Kapazitäten und Bezugsquellen bei Partnern soll sichergestellt werden, dass im Falle Exportbeschränkungen und etwaigen Preissteigerungen die betroffenen Industrien, damit die Wirtschaft und damit der Staat zumindest überleben können.
Um die Bedeutung Chinas für die Welt darzulegen: Als 2021 China aufgrund von Energiesparmaßnahmen Magnesium-Fabriken in zwei Fabriken herunterfuhr, stieg der Preis von Magnesium aufgrund der Verknappung um 260%. Alles, was China macht, hat direkte Auswirkung auf die Welt – und Europa. Mittlerweile sind 7% des chinesischen Handelsüberschuss Photovoltaik-Anlagen.
Problematisch an der Sache ist, dass der wichtigste Verbündete Europas – die USA – ebenfalls in diese Richtung wandeln.
Natürlich, American First gab es immer – denn jeder US-Präsident stellt natürlich die Interessen seines Landes über die anderer. So weit so unspektakulär. Doch die Ankündigungen, das Personal und die ersten Dekrete des wiedergewählten Präsidenten Donald Trump zeigen, dass es dieses Mal in eine harte protektionistische Richtung und damit Abkehr von Kooperation der westlichen Partner geht.
Bisher mag man vieles, womit US-Politiker gedroht haben, als scharfe Rhetorik gegenüber US-Wählern abtun, da die Umsetzung meist nicht so schlimm war, da sich auch die USA an internationale Abkommen und Partnerschaften gebunden fühlt und die Entscheidungsträger Argumenten und Kompromissen zugänglich waren.
Doch diese Zeit scheint vorbei.
„Buy American or get punished“ ist purer Protektionismus, den man vielleicht bei Autos noch umschiffen kann. Denn wie soll die EU-Bürger zwingen, amerikanische Autos zu kaufen? Ein Protektionismus, der aber spätestens bei der jüngsten Entscheidung Strafzölle auf Chips aus Taiwan zu erheben, eine massive Verwerfung in der demokratischen Welt verursacht: Eine Schwächung Taiwans, das eben durch die Stärke bei Chips eine gewisse starke Position behaupten kann, führt direkt zu einer Stärkung Chinas. Der Absturz der Technologie-Aktien nach Start des chinesischen AI-Programms DeepSeek zeigt, worauf die Welt zusteuern wird.
Europa hat dem nichts entgegenzusetzen und ist mittlerweile im Bereich Künstliche Intelligenz nur mehr Zuschauer. Europa hat keine KI-Konzerne, aber eine Regulierung.
Bei den Plattformen haben die USA schon gezeigt, in welche Richtung es gehen soll: Zuerst wurde TikTok verboten, nun soll es aufgesplittet werden. Ein Staat, der einen Verkauf an eigene Oligarchen erzwingt, das kannte man bisher nur aus Regimen. Dass Elon Musk rund um die Uhr gegen Europa wütet, aber keinerlei Problem damit hat, dass sein eigenes Unternehmen in mehreren Staaten dieser Welt verboten ist, sollte eventuell auch zu denken geben, auf was die Europäer einstellen können. Für viele einflussreiche Männer in den USA ist Europa mittlerweile der Feind.
Tesla betreibt eine Gigafactory in China. Und Tesla klagt gegen EU-Zölle gegen China. Eigentümer von Tesla: Elon Musk, dessen Firma X in China verboten ist.
Militärisch wird für Europa bald die Stunde der Realität schlagen: Jahrzehntelang hat der Kontinent die sogenannte Friedensdividende kassiert, hat sich auf den Schutz der USA verlassen. Innerhalb der NATO haben es so gut wie alle Staaten versäumt, das sich selber gesteckte 2% der Verteidigungsausgaben zu erreichen. Faktisch hat Europa abgerüstet, als schon ein Krieg im Osten Europas tobte. Welchen Anteil daran eine Naivität hat und welchen Anteil der russische Einfluss auf europäische Entscheidungsträger hatte, wird noch intensiv zu erforschen sein.
Die Abkehr der USA von Europa und die Hinwendung zum Asia-Pazifik-Raum sowie Südamerika zeigt sich unter anderem an der Reihenfolge der Telefonate, die der neue US-Außenminister Marco Rubio – noch einer der gemäßigten in der US-Administration – zum Amtsantritt führte. Das erste EU-Land war Polen, an 14. Stelle. Diese Abkehr ist aber nicht neu, sondern eine logische Folge der sich einerseits verändernden Weltlage, aber auch der demographischen Situation in den USA.
Der Katholik Joe Biden galt als einer der letzten klassischen US-Politiker, die noch eine Herkunft seiner Vorfahren aus Europa – idF. Irland – betonte und aufgrund seines politischen Werdeganges noch Verbindungen zu Europa hatte. Als Senator war Biden intensiv mit den Kriegen am Balkan und der Schaffung des Kosovos als eigenständigen Staat beschäftigt. Für seine Vizepräsidentin Kamala Harris war Europa keine Priorität.
Leider hat man nicht den Eindruck, dass die massiven geopolitischen Verwerfungen bei allen in Europa ein allzu großes Umdenken gebracht haben.
Noch immer verschließen viele in Europa die Augen vor der sicherheitspolitischen Realität.
In Österreich steht die gemeinsame Beschaffung für ein Luftabwehrsystem mit europäischen Partnern zur Diskussion. Unter dem Deckmantel der Neutralität soll die militärische Souveränität Europa weiter schwach bleiben. In den Koalitionsverhandlungen in Österreich steht SkyShield zur Disposition. In Deutschland ist die Zeitenwende abgesagt.
Unter Druck der Rechts- und Linksextremen knickt die deutsche Sozialdemokratie ein. Wer Führung bestellte, wie Bundeskanzler Scholz es bei seiner Wahl versprach, bekam Schwäche. Während im sozialdemokratisch regierten Norwegen alle Parteien des Parlaments eine Erhöhung der Mittel für die Ukraine mittragen, bildet sich wo anders eine Querfront Gegner des Westens und rechter und linker Extremisten.
Der Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen die Ukraine zeigt deutlich, wo auch in Europa sich teilt: Während die nordeuropäischen, die baltischen und viele mittel- und osteuropäische Staaten verstanden haben, was auf dem Spiel steht, flüchten sich Politiker auch der großen Staaten weiter in eine Welt des Friedens, die es so nicht mehr gibt – und auch nie gab.
As long as it takes wurde propagiert, doch man unternahm viel zu wenig, um es so short wie möglich machen. Zu wenig, zu spät – so kann man die Militärhilfe zusammenfassen. Steigen nun die USA aus, ist die Verteidigung eines europäischen Landes wohl verloren.
Wenn man hört, wie europäische Politiker sagen, dass man bereit sei einzuspringen, sollte Trump die Militärhilfe reduzieren, möchte man ihnen sofort entgegenrufen: Wieso habt ihr es dann bis heute nicht gemacht?
Der Krieg gegen die Ukraine steht so sinnbildlich für die sicherheitspolitische Schwäche Europas, weil es eben kein regionaler Konflikt ist. Sondern das widerspiegelt, wofür Großmächte stehen, die Europa eigentlich zu überwinden gehabt glaubte: Imperialismus, völkischen Wahn, Eroberung und Kontrolle, Unterwerfung und Missachtung aller Regeln des Völkerrechts – und der Zivilisation.
Der Kriege gegen die Ukraine ist der größte Angriffskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Russische Föderation wird unterstützt von Belarus, dem Iran, Nordkorea und China. In der Belagerung von Bachmut starben 10x mehr russische Soldaten als die USA in 20 Jahren Krieg in Afghanistan verloren. Und doch: Zu einer uneingeschränkten Unterstützung kann sich Europa bis heute nicht durchringen. Es fehlt an Waffen und Munition. Die eingefrorenen Assets bleiben nach Vetos mehrerer Staaten unangetastet. Die Sanktionen sind löchrig – zu viele Staaten wollen zu viele Ausnahmen – und die wichtigste Einnahmequelle des Kremls, Gas, wird von Europa weiter gekauft.
Sehr geehrte Damen und Herren, neben all diesen Themen – wissen Sie, was mich am meisten besorgt?
Die Spaltung der europäischen Gesellschaft. Wir sehen es in Österreich, wo sich Parteien mittlerweile über Social Media nur mehr Gehässigkeiten ausrichten. Wo sich die demokratische Mitte Nazis und Kommunisten nennt. Wohin das führen kann, sieht man am Westbalkan: Dort ist eines der Hauptprobleme der dortigen politischen Systeme der teils tiefsitzende Hass auf politische Mitbewerber ist und, dass jeder Kompromiss als Schwäche ausgelegt wird.
In den USA stürmen Extremisten das Kapitol. Der politische Mitbewerber wird zum Volksfeind.
Und auch man sehr vorsichtig sein sollte mit Rückgriffen auf die dunkle Geschichte, aber dass in Österreich ein Politiker öffentlich von Fahndungslisten für politische Gegner sprechen kann, zeigt, wie weit das Sagbare mittlerweile schon verschoben ist.
Die massive Polarisierung innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Politik offenbart aber auch eine erneut aufflammende Spaltung Europas.
Eine Spaltung nicht in arm und reich, nicht in Nord und Süd. Sondern eine Spaltung in der absoluten Grundsatz- und Prinzipienfrage, ob das demokratische System noch fähig ist, auf die Herausforderungen dieser Zeit zu reagieren.
Waren zu Beginn der vollen Invasion die Unterstützer Russlands noch ruhig und wohl in Schockstarre, sind mittlerweile alle Samthandschuhe ausgezogen. Offen unterstützen Parteien, auch in der Mitte, das russische Regime, eine Dominanz Chinas, eine Stärkung des Autokratenverbandes BRICS oder formulieren offen die Ablehnung der EU.
Nationalisten, die eine Nationenwerdung absprechen. Souveränisten, die einem Land die Souveränität absprechen. Anti-Imperialisten, die ein Imperium stützen. Volks-Politiker, die einem Volk die Selbstbestimmung verwehren.
Doch ist es auch ein Irrglaube, hier ständig mit dem Finger auf die politisch rechten Ränder zu zeigen. Der Krieg gegen die Ukraine dient hier als trauriges, aber anschauliches Beispiel.
Wer Russlands Angriffskrieg rechtfertigt, weil Sicherheitsinteressen über Souveränität anderer Staaten gehen, hebelt das Völkerrecht aus. Wer Trumps Annexionsgelüste gegenüber Grönland rechtfertigt, hebelt das Selbstbestimmungsrecht und Unverletzlichkeit von Grenzen aus und zementiert, dass Große Kleine kaufen oder erobern dürfen. Wer Abkommen auf Augenhöhe durch Deals zwischen Großen ersetzen möchte oder der Zerstörung internationaler Organisationen das Wort redet, schwächt damit alle Staaten, die nicht zu den Großmächten gehören. Damit Europa. Und damit Österreich.
Immer mehr Menschen verlieren den Glauben, dass Demokratie die Herausforderungen lösen kann. Reformstau, Blockaden, Partikularinteressen, Inflation, steigende Energiepreise, während man liest, wie andere mit Yachten-Umgehungsgeschäften hunderte Millionen einsparen. Eine gefährliche Gemengelage, die von Demagogen gnadenlos ausgenutzt wird.
Meine Damen und Herren, auch wenn ich bisher ein eher pessimistisches Bild der aktuellen Situation gezeichnet habe, darf ich Ihnen versichern: Hoffnungslos bin ich ganz und gar nicht.
Denn Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage.
Und da eine Niederlage des europäischen Systems genau das ist, was die Autokraten und Regime dieser Erde wollen, lohnt es sich, die Hoffnung nicht aufzugeben und für das europäische System zu kämpfen.
Ich halte das vereinte Europa – in Form der EU, aber auch in Form der friedlichen Kooperation der europäischen Staaten, der Menschenrechtskonvention, der internationalen Organisationen – für das Erfolgsmodell der Menschheitsgeschichte.
Nach dem Schrecken des ersten Weltkrieges und den unsagbaren Verbrechen gegen die Menschheit durch das Nazi-Regime, schaffte es Europa, seinen blutigen Nationalismus (das Gift Europas) abzuschütteln, dem Imperialismus zu entsagen, Menschenrechte als verbindlich anzusehen. Die friedliche Vereinigung von 27 Staaten, die sich darauf einigten, Souveränitäten abzugeben und ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ist einzigartig. Demokratie, Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und Solidarität, das christliche Menschenbild, Subsidiarität und individuelle Freiheit haben Europa zum freiesten und in Summe wohlhabendsten Kontinent gemacht. Die reichsten, sozialsten, demokratischsten und freiesten Staaten der Welt sind nicht umsonst diejenigen, die auf dem westlichen System basieren.
Auch in anderen Regionen dieser Welt gibt es Demokratie. Rechtsstaatlichkeit. Oder Wohlstand. Und ich habe viel Respekt für andere Gesellschaftsordnungen auf dieser Welt. Denn Toleranz und Offenheit sind auch Grundwerte Europas.
Dennoch muss ich ehrlich sagen, lehne ich mit jeder Faser meines Körpers ein System ab, in dem Menschen als Kollektiv gesehen werden und ein Regime dieses durch Druck zusammenhalten muss.
Andererseits möchte ich auch keine Gesellschaftsidee propagieren, in der survival of the fittest bis zum Extrem gelebt und in Los Angeles zwischen Bel Air und Skid Row, dem größten Obdachlosenviertel in den USA, zur traurigen Realität wird.
Was Europa ausmacht, sind seine Grundwerte oder, wie Papst Johannes Paul II einst sagte, die Seele Europas. Die Seele Europas entspringt aus der christlich-jüdischen Tradition, aus dem sich das Bild des Menschen mit Würde ableitet. Ein Menschenbild, das Subsidiarität als ein natürliches Ordnungsprinzip beinhaltet und das Freiheit, Eigeninitiative und Eigenverantwortung jedes einzelnen betont. Daraus ableitend die Marktwirtschaft, aber auch die Solidarität Anderen gegenüber.
Wie ich eingangs erwähnte: Der Mensch braucht eine Hoffnung. Eine Idee, die ihm gefällt.
Diese Seele Europas ist die Idee Europas. Und erlauben Sie mir, hier den großen Otto von Habsburg zu zitieren: Tragfähige politische Kräfte werden nur durch eine Idee geschaffen, denn diese ist die Seele – auch der Kontinente.
Doch eine Idee ist nur dann erfolgreich, wenn sie auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Und wenn Jaques Delors einst sagte, man kann einen Binnenmarkt nicht lieben, ist der Binnenmarkt ein Instrument, die Idee Europas umzusetzen.
Doch auch andere politische Maßnahmen sind dazu notwendig.
Eine echte gemeinsame Außenpolitik, die Europa nicht zum Spielball fremder Mächte macht. Eine Sicherheitspolitik, die nicht EU-Bürger einschränkt und Oligarchen Reisefreiheit gibt, sondern Europäer schützt.
Eine Wirtschaftspolitik, die Innovation und Fleiß belohnt, die familien- und eigentümergeführte Unternehmen sich entfalten lässt und nicht völlig illusorische Fantasiebewertungen von Tech-Konzernen zum Götzen erhebt.
Eine Handelspolitik, die Kooperation in den Vordergrund stellt und nicht Drohung und Einschüchterung. Eine Gesellschaftspolitik, die Eigenverantwortung statt Staatsgläubigkeit fördert. Einen liberalen Rechtsstaat, der Freiheit und Recht schützt, nicht Ideologien.
Eine Erweiterungspolitik, die die Grenzen der Freiheit nach Außen verschiebt, um auch die Mitte sicherer zu machen.
Europa braucht Integrität und Moral, aber kein Moralisieren. Denn hier besteht die Gefahr, schnell in die Doppelmoral abzugleiten.
Es wird noch schwer genug zu erklären sein, wieso ein Angriff Russlands auf die Ukraine oder ein Angriff Chinas auf Taiwan verurteilt und mit Sanktionen geahndet werden, ein etwaiger Angriff der USA auf Grönland aber nicht.
Europa muss erwachsen werden und seine Naivität ablegen. Europa muss mit aller Kraft die regelbasierte Ordnung stärken, denn nur diese schützt die Vielzahl an kleinen und mittleren Staaten gegen die Willkür der Großmächte.
Um die Eingangsfrage zu beantworten: Ich habe Hoffnung für Europa.
Erstens bin ich überzeugt, dass Europa auch durch Desinformation – nicht nur, aber teilweise auch bewusst im Zuge des hybriden Krieges – als schlechter dargestellt wird, als es der Realität entspricht.
Ein gigantischer Wolkenkratzer nach dem anderen in der Wüste ist architektonisch beeindruckend, sagt aber per se nichts über Qualität des Lebens dort aus. Ein Glas Weißwein auf der Piazza di Duomo in Florenz ziehe ich persönlich dem vor. Aber das ist reine Geschmackssache.
Doch als Europäer der Mitte sehe ich durchaus andere Faktoren, die ein Land, ein politisches System lebenswert machen:
In Russland, mit 143 Millionen Einwohnern, sterben jährlich 30.000 Menschen an HIV/Aids. n Deutschland- 80 Millionen Einwohner – rd. 300. In manchen Golf-Diktaturen sind 90% der Arbeitskräfte Migranten. Ehrlicherweise halte ich persönlich es für eine weit größere Leistung, als Land ohne Rohstoffe – wie Estland – mit Bildung, Demokratie und Marktwirtschaft Wohlstand aufzubauen, als mit reiner Ausbeutung von Bodenschätzen. Im World Competetivness Ranking sind von 69 Staaten 31 aus Europa. Dänemark war 2023 Nr. 1, 2024 Nr. 3 – hinter der Schweiz und Singapur. Im Global Peace Index sind unter den ersten 20 friedlichsten Ländern der Welt 15 europäische.
Man muss nicht naiv sein. Andere Länder holen auf. Der Wohlstand in vielen Regionen der Erde verbessert sich. Aber auch alle diese Länder haben massive Probleme.
In China schwächelt die Wirtschaft ebenso wie die USA massiven Diskurs zu Migration haben. Migration, fehlendes Wachstum – das sind Probleme in und für Europa, aber nicht genuin europäische Probleme.
Dennoch muss man konstatieren, dass Europa – das kein Staat ist – vor allem auch an Krisen wächst. Man kann leicht davon reden, dass der US-Präsident dieses oder jenes entscheidet und durchgreift. Ja, er hat auch die Exekutivgewalt in einem Land. Die EU besteht aus 27 souveränen Staaten.
Die Corona-Pandemie hat zum ersten Mal deutlich gezeigt, dass Staaten – auch nach anfänglich nationalen Alleingängen – kooperieren. Gemeinsame Impfstoffbeschaffung oder die green lanes der EU zeigten das.
Und in Europa konnten Menschen schon wieder feiner, als in China noch die Wohnungen von Kranken vernagelt und mit Drohnen überwachten waren. Die volle Invasion in der Ukraine 2022 hat auch gezeigt, dass Europa sicherheits- und verteidigungspolitisch umdenken und kooperieren kann. Ja, zu wenig, zu langsam. Aber 27 Staaten plus zig globale Verbündete zu vereinen bei einem Thema, das die Europäer völlig verdrängt haben – nämlich den Krieg – ist auch eine Leistung.
Mittlerweile gibt es in der Europäischen Kommission einen Koordinator für Verteidigungspolitik und mit einer Estin an der Spitze des Diplomatischen Dienstes, gab Europa auch die Dominanz der „großen westlichen Staaten“ in diesem Feld auf und nimmt die Sorgen der östlichen EU-Länder ernst.
Auch beim Thema Migration hat sich langsam ein strikterer Kurs durchgesetzt. 2023 gelang mit dem Asyl- und Migrationspakt in der EU eine umfassende Reform im Bereich Migration. Auch hier haben viele verstanden, dass der bisherige Weg nicht zielführend war. Und auch hier darf man nicht vergessen: Migration ist ein wichtiger Teil der hybriden Kriegsführung gegen Europa! 2023 hob die Militärregierung in Niger das 2015 auf Druck der EU erlassene Gesetz auf, das Migration nach Europa eindämmen sollte. Damit konnte damals die Schleusung von Migranten durch Niger reduziert werden. Nun ist das wieder straffrei gestellt.
Ein Angriff auf die EU – und auf die Menschenwürde.
Dies sind nur einige Beispiele von Themen, wo Europa in Krisen wächst.
Doch was Europa dringend braucht, sind Europäer. Menschen, die sich der Seele Europas verpflichtet fühlen und diese Prinzipien auch selber leben. Und es braucht Organisationen, die nicht nur europäische Werte fordern, sondern diese auch stolz im Namen tragen.
Europa ist ein Hoffnungsprojekt.
Denn nichts ist so hoffnungslos, dass wir nicht Grund zu neuer Hoffnung fänden.